
04/09/2025 0 Kommentare
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 33
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 33
# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 33
Nach dem 2. Weltkrieg – Russische Besatzung - DDR
Katholische Priester in Stralsund nach 1945, Teil 1
Das Sundschwimmen wurde erstmals 1948 als offener Wettkampf in der sowjetischen Besatzungszone ausgeschrieben. Seit 1949 wird alljährlich die Stralsunder Segelwoche ausgetragen. Stralsund ist dabei, sich nach dem Krieg wieder zu festigen. Für die katholische Gemeinde besteht die Aufgabe, die vielen katholischen Heimatvertriebenen zu integrieren. Dabei hatten die Kapläne große Aufgaben.

1)Kaplan Karl Paschke
Geboren am 01.April 1910 in Berlin-Wedding, geweiht am 29. Juni 1935 vom Nuntius Orsengio, zunächst Kaplan in St. Pius Berlin, danach in Karl Borromäus, Berlin-Grunewald. Er war von 01. Juli 1946 bis 01. Februar 1948 in Stralsund Kaplan, aber besonders in der Militärseelsorge der Marine tätig. Er wurde 1948 Kuratus/Pfarrer der Gemeinde Viereck und starb am 03. Februar 1983.
Fotos: Kapl. Paschke
Kaplan Karl Paschke: Gemeindeglieder und Andere berichten
In St. Sebastian in Berlin-Wedding ist Karl Paschke bis zur Schulzeit aufgewachsen. Von hier ging es zum Theologiestudium nach Breslau. Nach dem letzten Ausbildungsjahr im Priesterseminar Berlin-Hermsdorf wurde er zusammen mit elf weiteren Diakonen am 29.Juni 1935 in der St. Hewigs-Kathedrale durch Nuntius Cesare Orsengio zum Priester geweiht. Bischof Nikolaus Bares war am 01. März 1935 verstorben und Bischof Preysing noch nicht ernannt. (Cesare Orsengio war ein italienischer Geistlicher, Titularerzbischof und von 1930-1945 Apostolischer Nuntius in Deutschland.)
Nach seinem Dienst in Stralsund als Militärseelsorger in der Marine wurde seine Pfarrei die Gemeinde Viereck, eines der alten Pfälzer Dörfer, katholisch zumeist. Vielleicht hat Pfarrer Karl Paschke hier den Wert echter kirchlicher Tradition und die Bewährung im Glauben in besonderer Weise schätzen gelernt.
Katholische Pfarrei St. Johannes-Paul II. Uecker Randow, Pfarreirat
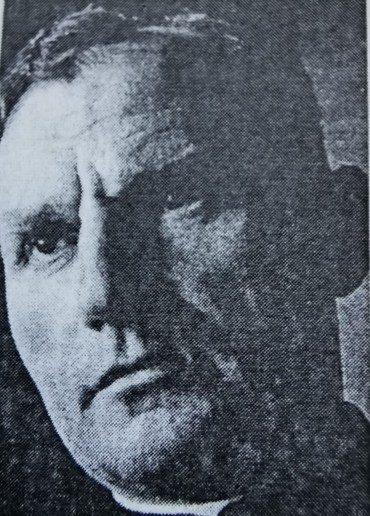
2) Kaplan Joseph, Dzierzon
Geboren am 26.März 1906, geweiht am 21. Dezember 1940. Er war von 01. Dezember 1948 bis 15. August 1953 Kaplan in Stralsund und starb am 19. Januar 1992
Kaplan Joseph Dzierzon: Gemeindeglieder und Andere berichten
Joseph Dzierson ist in Oberschlesien in Kreuzburg am 26. März 1906 geboren, nach der Schule absolvierte er ab 1928 das Technikum in Mittweida und war als Elektroingenieur in Nürnberg und Berlin Siemensstadt tätig. Er macht 1934 das Abitur, dann geht er zum Theologiestudium nach Breslau und Fulda (1936-1940), dann Priesterseminar in Berlin-Grünau und Breslau-Carlowitz bis 1941. 1941 wird er zum Priester für die Diözese Berlin geweiht, ist Kaplan in Königs Wusterhausen eingesetzt, von 1941- 1945 Kriegsdienst als Sanitäter. Er wird in der Kriegsgefangenschaft Wehrmachtspfarrer, dann Flüchtlingsseelsorger in Lensahn, 1946 Kaplan in St. Mauritius Berlin-Lichtenberg, ab 1948 Kaplan in Heilige Dreifaltigkeit Stralsund, 1953 Kuratus von Herz Jesu in Wolgast, 1955 bekam er denTitel Pfarrer, 1960 Kuratus von St.Petrus in Leegebruch, dann Hausgeistlicher im Caritas-Heim in Bad Saarow, er verstirbt am 19.01.1992 in Berlin –Weißensee.
Aus dem Diözesanarchiv Berlin
Vgl. u.a. Pfarrer Joseph Dzierzon, in: St. Hedwigsblatt, Nr. 51, 19. Dezember 1965. – 40 Jahre Priester, in: St. Hedwigsblatt, Nr. 50, 14. De¬zember 1980. – 40 Jahre Priester, in: Petrusblatt, Nr. 51/52, 19. Dezember 1980. – Pfarrer Joseph Dzierzon 50 Jahre Priester, in: St. Hedwigsblatt, Nr. 50, 16. Dezember 1990. – Nachrufe: Kath. Kirchenzeitung für das Bistum Berlin, Nr. 5, 2. Februar 1992; Petruskalender 1993, 100 f. Bestandsinformation Nachlasssplitter: Persönliche Dokumente – Wehrmacht¬spfarrer/Flücht¬lingsseelsorger in Lensahn 1945–1946 – Predigten in St. Mauritius Berlin-Lichtenberg 1946–1947 – Herz Jesu Wolgast 1953 ff

3) Kaplan Gerhard Kuhn
Geboren am 02. Juli 1926 in Klein Kronau /Allenstein - Ostpreußen, geweiht am 24.06. 1952 von Bischof Wilhelm Weskamm. Erste Kaplanstelle in St. Laurentius Berlin-Spandau, dann vom 15. August 1953 bis 15. Februar 1956 bei uns Kaplan, dann Kuratus in Heilig Kreuz in Garz, danach Pfarrer in Wittenberge, im Ruhestand ab 01.08.1997 und starb am 20. September 2002
Fotos: der Priester
Kaplan Gerhard Kuhn: Gemeindeglieder und Andere berichten
Gerhard Kuhn war von 1948 bis 1997 Pfarrer in Wittenberge. In der Chronik der Gemeinde St. Heinrich Wittenberge wird berichtet:
„Pfarrer Gerhard Kuhn führte ab 1972 das Wiederaufbaukonzept seines Vorgängers Pfarrer Bolwin, (siehe Episode 12 “Erste Stralsunder Primiz“), nicht weiter. Er betrieb ab dem Zeitpunkt die bis heute umstrittene Modernisierung und Verfremdung des Kircheninnenraumes, die Rundbögen begradigt, die Decke tiefergehängt, das Hauptportal zugemauert. Aus einer Längsausrichtung der Kirche wurde eine Quer-Ausrichtung. Der Dresdner Bildhauer Friedrich Press schuf aus rohem Beton in abstrakter Form vier Wandskulpturen (Die Passion Christi). Der Altar (Das Grab Jesu) und die Tabernakelsäule (Himmelfahrt Christi) stammen ebenfalls von Friedrich Press………“.
Pfarrbrief St. Heinrich 1997
Haben wir in „Heilige Dreifaltigkeit“ in Stralsund nicht auch mit architektonischen Vorstellungen von Friedrich Press gerungen? Ebenso in Stralsund in der evangelischen „Auferstehungskirche“!
Beerdigungsort:
Pfarrer Gerhard Kuhn
Geburt:2 Juli 1926
Gestorben: 20 Sept 2002 (im Alter von 76)
Bestattung :Friedhof St. Matthias Tempelhof, Tempelhof-Schöneberg, Berlin,
Am 8. Mai 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende und Deutschland wurde vom Nationalsozialismus befreit. Die evangelische Kirche hatte bereits im Oktober 1945 das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis abgelegt, die katholische Kirche brauchte etwas länger, um sich ernsthaft mit der eigenen Rolle im Nationalsozialismus und dem verbrecherischen Krieg auseinanderzusetzen. Seit den 1960erJahren ist das mehrmals geschehen - zuletzt Ende April im "Wort der Deutschen Bischofskonferenz zum Kriegsende".
Die katholischen Bischöfe hätten sich in den 1930er und 40er Jahren mitschuldig gemacht, weil sie dem Krieg kein eindeutiges Nein entgegenstellten. Vielmehr hätten sie den Willen zum Durchhalten gestärkt, so steht es in der aktuellen Erklärung der katholischen Oberhirten, die von der Kommission „Justitia et Pax“ vorbereitet wurde, deren Vorsitzender der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer war.
"Aus einem kirchlich-traditionellen Obrigkeitsverständnis heraus hat man die Soldaten zu Gehorsam und Pflichterfüllung aufgerufen", so der Bischof. Die Protestanten hätten unmittelbar nach Kriegsende zwar ihre indirekte Mitverantwortlichkeit für nationalsozialistische Verbrechen erklärt, nach dem Krieg diese Einsicht aber teilweise relativiert: "Es wurde daneben gestellt, wir waren auch in einer großen Gemeinschaft des Leidens und die eigene Betroffenheit breit dargestellt".
Christen, die den Krieg verweigerten oder sich dem Nationalsozialismus entgegenstellten, wurden in beiden Kirchen auch nach 1945 lange Zeit verachtet oder nicht gewürdigt. Dorothee Godel nennt als Beispiel den Umgang mit dem evangelischen Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 hingerichtet wurde: "Als 1953 die erste Gedenkveranstaltung im KZ Flossenbürg abgehalten wurde, ist der bayerische Landesbischof Hans Meiser demonstrativ ferngeblieben und bis in die 70er Jahre galt Bonhoeffer vielen als ehrloser Vaterlandsverräter. Und das hat sich völlig gewandelt: Inzwischen ist Bonhoeffer zum Vorbild geworden."
Leben unter den Bedingungen der DDR
Die Bevölkerung reagierte zunehmend verbittert, was sich unter anderem darin zeigte, dass von Juli 1952 bis 1953 insgesamt 338.896 Menschen in die Bundesrepublik flüchteten. Obwohl der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 eine vorübergehende Mäßigung des harten Regierungskurses zur Folge hatte und der sogenannte „Neue Kurs" mit diversen Erleichterungen eingeführt wurde, änderte sich an der dominierenden Machtstellung der SED-Führung nichts. Dieser Kurswechsel kann nicht als neue strategische und taktische Etappe der Politik der SED im Auftrag der Sowjets betrachtet werden, sondern vielmehr als ein temporäres Zurückweichen angesichts der Empörung der Bevölkerung mit dem Ziel, bei Gelegenheit wieder auf den alten Kurs zurückzukehren.
Bereits auf dem IV. Parteitag der SED vom 30. März bis 6. April 1954 wurden mit wenigen Ausnahmen die Änderungen nach dem Juni-Aufstand revidiert und die ursprüngliche harte strategische und taktische Konzeption fortgesetzt. Darüber hinaus wurde die politische Linie gegenüber der Bundesrepublik verschärft und offen vom Sturz des Adenauer-Regimes gesprochen, wobei es um die Angleichung der Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik an die der SBZ ging.
Auch die Revolutionen in Ungarn und Polen 1956 sowie der systematisch entwickelte Modernisierungsprozess des Stalinismus in der Sowjetunion haben die Strategie und Taktik der Sowjets gegenüber Deutschland und insbesondere gegenüber der SBZ kaum verändert. Die SED blieb innerhalb des Ostblocks eine der reaktionärsten stalinistischen Parteien und hat keine Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, die in der KPdSU bereits etabliert waren. Derzeit war keine Veränderung in der SED absehbar. Nach wie vor kontrollierte der vom Politbüro geführte dominante Machtapparat der SED das gesamte politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben der SBZ und steuerte nach den Richtlinien der Sowjets die Infiltrationspolitik in der Bundesrepublik. Er beherrschte die bürgerlichen Parteien, die Massenorganisationen ebenso wie die Scheinparlamente und Verwaltungen.
Im Jahr 1960 konnte festgestellt werden, dass in Bezug auf das von den Sowjets kontrollierte deutsche Gebiet das erste große strategische Etappenziel erreicht worden ist. Die unabhängige Arbeiterbewegung in Mitteldeutschland wurde zerschlagen und mit der SED ein Instrument geschaffen, das bedingungslos alle Befehle aus Moskau ausführt.
In Gedenken an Frau Felicitas Knoppke; verstorben 2024
überarbeitet von Roland Steinfurth
Korrektur Wolfgang Vogt
Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund


Kommentare