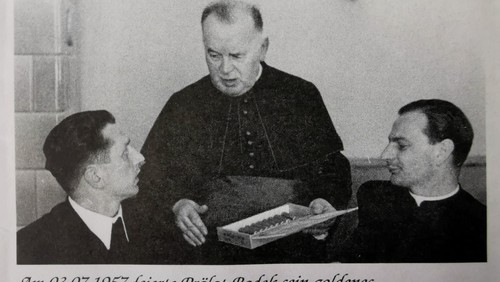
18/07/2025 0 Kommentare
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 28-3
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 28-3
# Jubiläum250
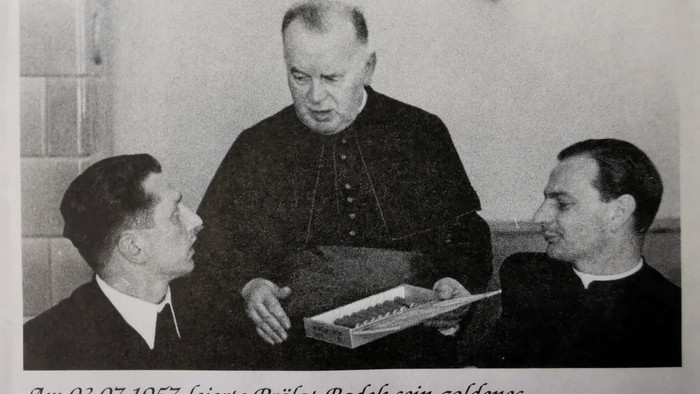
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 28-3
Friedrich Radek - Sein Leben
Katholischer Priester – Durchsetzer und Querkopf
Prälat Friedrich Radek – Teil 3

Pfarrer Radek war immer auch ein politischer Mensch und Kämpfer. Er war Mitglied der Zentrumspartei und nach dem Krieg in Stralsund Mitbegründer der CDU in der russischen Besatzungszone. Als im Jahre 1925 während des Wahlkampfes für die Reichspräsidentenwahl in Demmin ein Flugblatt verbreitet wurde, in dem angeblich der Vorsitzende der Zentrumspartei in Stralsund empfahl, Hindenburg zu wählen, gab Radek in der Zeitung „Der Vorpommer“ folgende Erklärung ab: „Den Katholiken des Kreises zur Kenntnis…… Der Führer des Zentrums in Stralsund bin ich. Ich habe öffentlich erklärt: Einen alten Herrn, der in 7 Jahren 85 Jahre alt sein wird, zum Präsidenten des Deutschen Reiches machen zu wollen, ist eine Komödie und bodenlose Gewissenlosigkeit. Ich habe dieser meiner öffentlichen Erklärung nichts hinzuzusetzen und nehme von ihr nichts zurück……“ Daraufhin kam es zum Eklat, denn der Rat verlangte beim Kardinal die sofortige Versetzung des Erzpriesters. Er erhielt darauf aber keine Antwort. Sieben Tage später erschien im „Stralsunder Tageblatt“ und in anderen bürgerlichen Zeitungen Deutschlands eine Erklärung des Stralsunder Kirchenvorstands.“ Wir sind an dem herausfordernden Verhalten des Herrn Erzpriesters Radek anlässlich des Wahlkampfes für die Reichspräsidentschaftswahl völlig unbeteiligt und missbilligen entschieden die von ihm gemachten Äußerungen“ , unterschrieben von 9 der 13 Mitglieder. Auch sein Kaplan Georg Heisig hatte sich an dieser Aktion beteiligt. Dies empörte sogar die evangelischen Christen der Stadt, die voller Hohn und Verachtung auf die Katholiken hinwiesen. Erst nachdem der spätere Generalvikar, Prälat Steinmann, mit dem Kirchenvorstand verhandelt hatte, schreibt Pfarrer Radek in seiner Chronik: „ Es kam ein lahmer Frieden zustande. Für lange Zeit blieb auf beiden Seiten ein ziemliches Maß von Abneigung.“

Während seiner Amtszeit kommt es aber immer wieder zu Kontroversen in der Gemeinde, an der oft seine Kapläne nicht unbeteiligt sind. Als Akademiker in der Pfarrei einen Stammtisch gründeten, zu dem auch der Kaplan gehörte, schloss man den Pfarrer aus diesem Kreis aus. Erst viele Jahre später wurde es ihm erlaubt, daran teilzunehmen.
Wenn Pfarrer Radek sich nach außen hin immer kämpferisch zeigte, so war er in seinem Hause auf den inneren Frieden bedacht. Für seine jungen Kapläne, die er bei ihrer Ankunft mit den Worten begrüßte:“ Fühlen Sie sich wie im Hause Ihres Vaters“, war Stralsund für Kapläne nicht gerade eine Traumstelle. Durch seine autoritäre Art, die an oberschlesische Pfarrherren erinnerte, kam es immer wieder zum Kleinkrieg. Geduldiges Ertragen Andersdenkender war durchaus nicht seine starke Seite, und durch manche sarkastische Äußerung kränkte er seine Mitarbeiter, die er aber sehr oft väterlich „Kinderchen“ nannte. Spannungen konnte er aber schwer ertragen und war immer wieder froh, wenn das versöhnende Wort gesprochen war. Es scheint auch, dass die Stadt nach einiger Zeit endlich mit ihm Frieden geschlossen hatte. Seit Jahren kämpfte sie um einen Staatszuschuss für den Ausbau der Hafenanlagen, die 3 Million Mark kosten sollte. Der Rat wandte sich im Jahr1929 an Radek als Vorsitzenden der Zentrumspartei. Dieser reiste nach Berlin, und es gelingt ihm, das Zentrum im Preußischen Landtag für sein Projekt zu interessieren, und Stralsund erhält seinen Zuschuss.

Als der Seelsorger 1932 sein Silbernes Priesterjubiläum feierte, schien auf allen Seiten Frieden zu herrschen. Die ganze Gemeinde ehrte ihren Pfarrer. Der Generalvikar aus Berlin, viele Geistliche aus den Nachbargemeinden, Vertreter der Stadt, der Regierung und des Militärs überbrachten Glückwünsche. Auch der Kantor der jüdischen Gemeinde erschien persönlich mit einer riesigen Hortensie.
Pfarrer Knauft aus Berlin schreibt in seinem Buch über Radek:“ Von einer heimlichen Versuchung der ermüdenden Diaspora-Situation scheint Erzpriester Radek immer freigeblieben zu sein, sich von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt in ein frommes Ghetto zurückzuziehen. Kirche war für ihn immer Kirche in der Welt. Selbst wenn die katholische Gemeinde zahlenmäßig klein war, so sollte sie dennoch nicht in ein Winkel-Dasein abgedrängt werden.“ Radek nutzte sogar manche Gelegenheit, um die Präsenz der Diaspora-Kirche in der Öffentlichkeit zu betonen. Als der neuernannte Berliner Bischof Dr. Christian Schreiber 1930 zum ersten Mal Stralsund besuchte, bereitete Radek ein geradezu festliches Programm vor: Empfang durch den Oberbürgermeister und den Chef der Hochseeflotte, Rundfahrt des Bischofs durch Rügen, Feuerwerk zu Ehren des Bischofs und abschließend Eintrag ins Goldene Buch von Stralsund.
Trotz seiner Erfolge bei der Verwaltung der Pfarrei, es war ihm gelungen, bis 1941 alle Hypotheken und andere Schulden zu tilgen, ein in der Geschichte der katholischen Pfarrei Stralsund noch nie da gewesener Zustand, so hat Friedrich Radek doch viele Jahre um die Durchsetzung seiner Ideen und um Anerkennung kämpfen müssen.
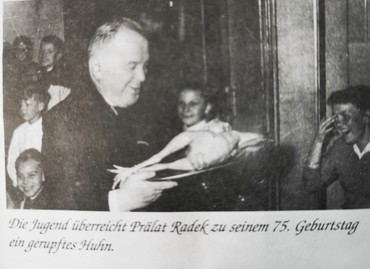
Auch im Alter nahm Pfarrer Radek jede neue seelsorgliche Herausforderung an. Bequemlichkeit verurteilte er. Auf einem Dekanatskonvent sprach er über die „Klerikale Trägheit“. Er sagte seinen Mitbrüdern:“ Priester sind in er besonderen Gefahr, in eine Phase der Trägheit abzugleiten.“ Als getarnte Form des Müßiggangs nannte er: “ Man sammelt Marken, Münzen, Schmetterlinge, Steine, treibt Rosen-, Bienen- und Taubenzucht, sitzt stundenlang am Klavier, treibt Kunst und Kunstgeschichte. Alles sehr schön und sogar zu loben, wenn nur wirklich frei Zeit dafür verwendet wird und nicht zur Hauptsache wird und Berufsarbeit zur lästigen Abhaltung.“ Er verurteilte Mitbrüder, die erst am Samstag ihre Sonntagspredigt vorbereiten. Er selbst begann damit bereits am Wochenanfang.
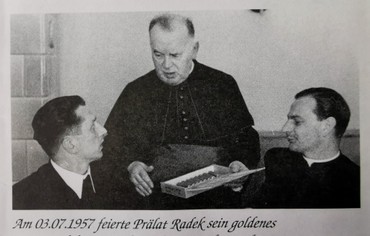
Nachdem im Jahre 1933 die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, hatten sie die Angriffe Radeks gegenüber ihrer Partei nicht vergessen. 1931 hatte er einem arbeitslosen Anhänger Hitlers, der seine Kirchensteuer nicht bezahlen wollte und meinte, er könne dies erst, wenn Hitler an die Macht käme und es ihm dann besser ginge, schriftlich geantwortet: „Wenn Hitler zur Regierung kommt, werden sofort alle Banken leer sein….. leider gilt das Wort: „Wen Gott verderben will, dem nimmt er den Verstand“, und setzte hinzu: „ und schickt ihn zu Hitler“. Diesen Briefwechsel veröffentlichte das NS-Organ „Angriff“ mit folgendem Kommentar:“ Kriegslüge, Nazi-und Hitler-Hetze: so, genau so, haben wir uns immer einen wahren Priester vorgestellt.“ Unter der Überschrift“, Der politisierende Seelsorger“ wird er wenige Tage später erneut angegriffen. Er hatte einem jungen Mann, dessen Vormund er war, versucht auszureden, sich für 12 Jahre bei der Reichswehr zu verpflichten. „Er wisse als Seelsorger der Reichsmarine, wie schwer es einem Soldaten gemacht werde, seine religiös-kirchlichen Pflichten zu erfüllen“. Daraufhin bezichtigte man ihn der Verleumdung. Es kam zu einem Streit zwischen Radek und der Marinebehörde in Kiel, der damit endete, dass Radek auf verlangen des Chefs dieser Behörde 1931 sein Nebenamt als Marineseelsorger niederlegen musste. Trotz aller Querelen und Angriffe von Seiten der Nationalsozialisten ging Friedrich Radek während des Dritten Reiches konsequent und mutig, wenn auch etwas vorsichtiger seinen Weg weiter. Die Geheime Staatspolizei war regelmäßig ein unliebsamer Gast in seinem Hause. Vorwürfe, er habe die Predigt des Bischofs von Münster verbreitet und sich gegen den Film „Ich klage an“ öffentlich ausgesprochen (in beiden Fällen ging es um die von Nationalsozialisten propagierte Euthanasie) und auch gegen Vorwürfe, er sei polenfreundlich, konnte der redegewandte Pfarrer diplomatisch entkräften. Es bestand durchaus die Gefahr, dass Radek in Haft genommen werde. Polenfreundlichkeit hatte die Pfarrer von Demmin und Swinemünde ins KZ Dachau gebracht, und ein Jahr später (1943) werden sechs Geistliche aus dem Dekanat verhaftet, insbesondere sei auch auf den „Fall Stettin“ hingewiesen. Besonders hart trifft ihn die Schließung der katholischen Schule 1939 und die Beschlagnahme des Waisenhauses 1943.
In Gedenken an Frau Felicitas Knoppke; verstorben 2024
überarbeitet von Roland Steinfurth
Korrektur Wolfgang Vogt
Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund


Kommentare