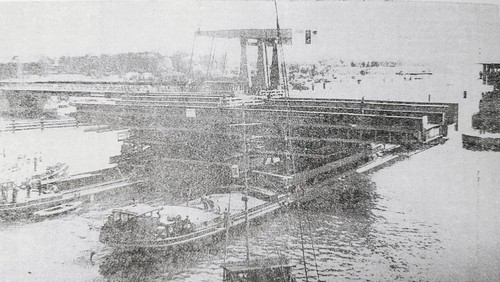
18/07/2025 0 Kommentare
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 28-2
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 28-2
# Jubiläum250
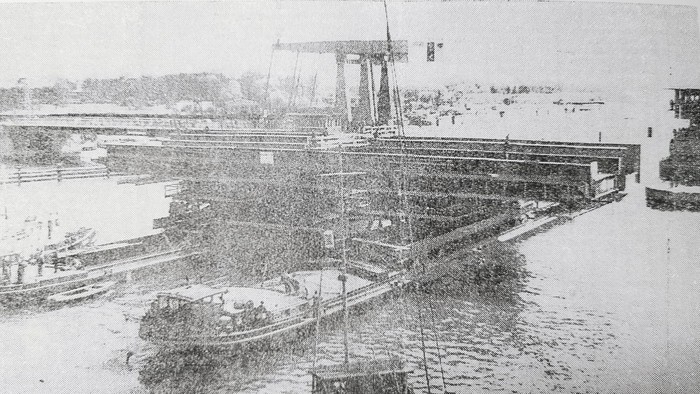
Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 28-2
Friedrich Radek - Sein Leben
Katholischer Priester mit Ausdauer und Konsequenz
Prälat Friedrich Radek – Teil 2
Retter von Stralsund, Pommerscher Landpriester oder Recke vom Sund, so nannte man ihn, Prälat, Monsignore, Pfarrer Friedrich Radek. Als zweites Kind von 13 Geschwistern am 10. November 1884 in Berlin geboren, war er doch ein Oberschlesier von echtem Schrot und Korn. Denn als sein Vater bald darauf in Oberglogau eine kleine Druckerei erwarb, zog die Familie nach Oberschlesien. 1889 gründete er dort als Verleger und Chefredakteur die „Ober Glogauer Zeitung“. Der Vater war ein Mann von sprühendem Geist, großem Erzähltalent, der mit spitzer Feder seine Beiträge schrieb. Von ihm hat Friedrich die Intelligenz, die Impulsität, die Entscheidungsfreudigkeit und den Umgang mit dem gedruckten Wort geerbt; von der Mutter, einer Berlinerin, den Sinn für das Praktische, das Machbare und die tiefe Frömmigkeit. Ihr Lebensmotto: „Ich will, ich kann, ich muss“ übernahm der Sohn für sein ganzes späteres Leben.
Nach Abschluss des Theologiestudiums weihte ihn Kardinal Kopp 1907, mit 22 Jahren in Breslau zum Priester. Sein erstes theologisches Examen weist durchweg die Note sehr gut aus, nur im Fach Apologetik, später in der Seelsorge sein Steckenpferd, musste er sich mit dem Prädikat gut bis sehr gut zufriedengeben.
Im Fürstbistum Breslau, damals das zweitgrößte der Welt, das sich von Oberschlesien bis zur Ostsee erstreckte, lebten 3 Millionen Katholiken, darunter auch viele polnisch sprechende Gläubige. So wie viele seiner Mitbrüder, erlernte Radek auf dem Seminar die polnische Sprache, um auch in polnisch sprechenden Gemeinden eingesetzt werden zu können. Mit seinen Sprachkenntnissen muss es aber nicht weit her gewesen sein. Denn nach einem Gottesdienst kamen einmal polnische Gottesdienstbesucher zu ihm, bedankten sich beim Festprediger für die schönen zu Herzen gehenden Worte in ihrer Muttersprache und bemerkten: “Ja Herr Kaplan, jetzt verstehen wir doch wenigstens schon etwas“.
Seine erste Kaplanstelle war die große Arbeiterpfarrei Biskupitz im oberschlesischen Industriegebiet. Hier gründete der junge Priester eine Pfarrbücherei mit über 3000 Bänden. Dieser junge Mann, der sich so aktiv für die Weiterbildung der Arbeiter einsetzte, war den Regierungsbeamten in Oppeln sehr bald nicht genehm. Man drohte ihm eine Hausdurchsuchung an, gegen die sich Radek in Zeitungsartikeln vehement zur Wehr setzte, so dass diese unterblieb.
Er war nicht der „Stille im Lande“, er wollte sich einmischen, nahm kritisch auch zu politischen Fragen Stellung. Für ein „frommes Sakristei Christentum“ hatte er nichts übrig. Wortgewandt und polemisch nahm er Stellung bei Landtags- und Gemeindewahlen gegen die ungerechte Behandlung und Zurücksetzung von Katholiken bei der Vergabe von Ämtern im öffentlichen Dienst. Eine angeblich vom preußischen König Friedrich II. verfasste Geheimverfügung, in der es wohl hieß: „Kein Katholik darf Bürgermeister werden, kein Katholik darf eine Beamtenstelle bekommen, die mehr als 300 Thaler Gehalt beträgt“, trug nicht zum guten Verhältnis von katholischen und evangelischen Christen bei. Der junge Priester war sehr bald nicht nur den weltlichen Behörden, vermutlich auch seinen Vorgesetzten im Ordinariat ein unbequemer Mann. Man berief ihn deshalb 1912 als Kaplan nach Nauen bei Berlin. Eine Versetzung in die Diaspora nach Brandenburg und Pommern galt damals beim schlesischen Klerus als Strafversetzung. Radek sah dies aber als eine Herausforderung an. Er wollte auch hier gerne das Evangelium verkünden und Erfahrungen in der Diasporaseelsorge sammeln, aber immer in der Hoffnung, irgendwann ins „goldene Schlesien“ zurückzukehren. Dass es niemals dazu kommen würde, konnte er damals noch nicht wissen. Er blieb sein Leben lang Diasporapriester. In Brandenburg hatte er die Aufgabe, die katholischen Viehhüter in dem riesigen Havelländischen Luch auf ihren einsamen kleinen Höfen zu besuchen. Dazu brauchte er 5 Stunden quer durch das Moor. Diesen Weg konnte man nur bei hellstem Sonnenschein wagen. Ein Schritt zu weit links oder rechts und der Wanderer wäre rettungslos im Moor versunken.
Hier, wie auch an anderen Orten, in denen er später Pfarrer war, gehörten polnische Schnitter zur Gemeinde. Diese einfachen Menschen lagen ihm besonders am Herzen. Für ihn war der Mensch wichtig und nicht die Nationalität. Besonders während der beiden Weltkriege nahm er sich ihrer an. Im I. Weltkrieg kamen viele polnische Paare zu ihm, die heiraten wollten, aber keine notwendigen Papiere vom Staat erhielten. Der junge Kaplan löste dies auf seine Weise, indem er die kirchliche Trauung ohne vorherige standesamtliche vollzog. Dies tat er auch später in Belgard und in Stralsund. Manchmal gingen solche spontanen Aktionen allerdings nicht gut aus. In zwei Fällen kam es zu einem Gerichtsverfahren und er wurde in Köslin zur Zahlung von 50 Mark verurteilt. Im zweiten Fall in Stralsund sollte er 50 Millionen bezahlen. Radek erhob Einspruch. Der Richter entgegnete Ihm :“ Aber Herr Pfarrer, zu weniger als zu einer halben Bahnsteigkarte können wir sie wirklich nicht verurteilen“. Es war die Zeit der Inflation, und eine Bahnsteigkarte kostete zu dieser Zeit 100 Millionen Mark.
Die Kunde von seinem tatkräftigen Wirken in der Diaspora war schließlich bis nach Breslau gedrungen. Adolf Kardinal Bertram beruft den jungen Priester 1915 als Kuratus nach Belgard an der Persante in Hinterpommern. Am 31. August traf er dort ein. Er war der erste ständige katholische Ortsgeistliche seit den Tagen der Reformation. Am 1. September früh um 7.00 Uhr feierte er die hl. Messe für Katholiken von Belgard und Umgebung, und die zweite am Tage darauf für die Verstorbenen des Bezirks. Was ihn hier in der hinter pommersche Stadt erwartete, waren nicht gerade Verhältnisse, die einem jungen Priester Mut machen konnten. Seit vielen Jahren bemühte sich die kleine Gemeinde um den Ankauf eines Grundstücks zum Bau einer Kirche, was aber immer wieder am fehlenden Geld scheiterte. Sie mussten den Gottesdienst in Privatwohnungen und manchmal auch in verrauchten Kneipen feiern. Bei der Suche nach einem geeigneten Raum stießen sie oft auf heftigen Widerstand. Äußerungen wie „Wenn das katholische Volk hier einzieht“, oder wie eine adlige Dame sich auszudrücken pflegte „Wenn das katholische Pack hier einzieht, ziehen wir aus!“ 2 waren keine Seltenheit. Ökumene war um diese Zeit noch ein Fremdwort.

Als Radek nach Belgard kam, diente ein alter Wagenschuppen einer Schmiede als katholische Kirche. Doch ihre Ausstattung befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Auf einem Tisch standen zwei mit Sand gefüllte Blechdosen als Kerzenständer. Ein schiefer Kelch, eine Albe, ein Schultertuch und drei z.T. fadenscheinige Messgewänder, ebenso ein altes Messbuch im Taschenbuchformat standen ihm zur Verfügung. Aber wie groß die Schwierigkeiten auch waren, sie konnten einen Mann wie Friedrich Radek nicht abschrecken. Es musste ihm gelingen, diese armseligen Verhältnisse der Gemeinde recht bald zu verbessern.
Ein würdiges Gotteshaus musste errichtet werden, und er wusste, mit Gottes Hilfe würde ihm dies gelingen. Schon bevor er nach Belgard kam, gab es bereits Pläne für eine Kirche und auch 63.000 Mark waren durch Sammlung im ganzen Deutschen Reich eingegangen. Der Krieg machte den Plan zunächst einmal zunichte, und die Not der Nachkriegszeit schien den Bau für immer verhindern zu wollen. Kuratus Radek blieb aber keinen Tag in dieser Sache untätig. Er sammelte weiter, verhandelte mit weltlichen und geistlichen Behörden und am 12. November 1920 ist es dann endlich so weit. Er legte den Grundstein für die Kirche, die ein Jahr später konsekriert werden konnte.
Bei der Grundsteinlegung staunten die Belgarder Zuschauer über die vielen katholischen Teilnehmer, darunter auch eine Reihe angesehener Personen. Die Protestanten wunderten sich und meinten:“ So gehören zu den Katholischen auch bessere Leute? Wir dachten immer, solche Leute gehen nicht zu den Sekten.“
Als Radek die Gemeinde in Hinterpommern verließ, hinterließ er seinem Nachfolger ein würdig ausgestattetes Gotteshaus und eine ordentliche Dienstwohnung, außerdem waren alle Schulden, die bei dem Bau entstanden waren, beglichen.
Seine nächste Station hieß dann Stralsund. Am 15. August 1922 hielt er seinen Einzug in unsere Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit. Nach Berlin und Potsdam gehörte Stralsund im Nordosten zu den ältesten Pfarreien. Es gab hier seit über 100 Jahren eine Kirche mit großem Pfarrhaus, eine katholische Schule und das Waisenhaus. Was lag näher, als dass den Gottesmann hier geordnete Verhältnisse erwarteten. Weit gefehlt ! Sein Vorgänger, Pfarrer M. Wahl, ein väterlicher, gütiger, älterer Herr, ging nach Oberschlesien zurück und hinterließ in Stralsund einen großen Freundeskreis in der Gemeinde und in der ganzen Stadt. Vermutlich hatte er den Herren des Kirchenvorstandes ziemlich freie Hand gelassen. Und die finanzielle Verwaltung der Pfarrei kann, bei all seinen Verdiensten, nicht seine große Stärke gewesen sein, denn bei der Ankunft des neuen Pfarrers gab es enorme finanzielle Schwierigkeiten. Die Einnahmen der Kirchenkasse reichten nicht aus und wurden durch das Waisenhaus und die Schule stark belastet. Der Pflegesatz des Staates für die Kinder war völlig unzureichend, für zwei Kinder zahlte niemand. Auch der Zuschuss für die Schule war so gering, dass er nicht einmal ausreichte, um Kohlen für einen einzigen Klassenraum zu kaufen. Auch der Regierungszuschuss zum Pfarrgehalt blieb aus. Kirchensteuern waren nicht beschlossen und konnten somit nicht erhoben werden. Lediglich einige polnische Schnitter schickten freiwillige Beiträge. Erschwerend kam hinzu, dass das Geld während der Inflation von Stunde zu Stunde seinen Wert verlor. So konnte auch der Bonifatiusverein, sonst immer der Retter in der Not, kaum helfen, denn das Geld verlor seinen Wert auf dem Wege vom Spender zum Empfänger.
Die Ausstattung der Sakristei war äußerst mangelhaft. Es gab wenig Messwein, kaum Kerzen und einige wenige Paramente. Die Dächer der Kirche und des Pfarrhauses waren undicht. Da besann sich der neue Pfarrer vermutlich auf die Worte seiner Mutter:“ Ich will, ich kann, ich muss!“ und fing wieder einmal ganz von vorne an. Erst musste Geld herangeschafft werden. Er forderte die Gemeinde also auf, die Kollekte der Geldentwertung anzupassen. Diesen energischen Ton kannte man in Stralsund nicht und viele empörten sich. Auch an die Stadt stellte er Forderungen, ihren finanziellen Pflichten nachzukommen. Ein harter Kampf, der sich über viele Jahre hinzog, der sogar bis in sein persönliches Leben hineinreichte, entbrannte mit dem Rat und den Kirchenvorstehern. Radek erreichte schließlich, dass die Stadt die Heizung für die Schule und die Armenkasse den Pflegesatz für die zwei Waisenkinder und außerdem generell die Erhöhung der Pflegesätze übernahm. Der Oberbürgermeister und sein zuständiger Ratsherr beschwerten sich über die unersättlichen Forderungen des neuen Pfarrers. Radek musste sich des Öfteren hämischen Äußerungen wie „ Die Kirche hat einen großen Magen“ oder „Gehen Sie doch betteln!“ anhören. Als der Ratsherr schließlich drohte:“ Wenn Sie so viel verlangen, werden wir die Kinder anderweitig unterbringen!“ antwortete Radek:“ Bitte, Sie können alle Kinder haben !“ Danach gab die Stadt auf.
Trotz der schweren Zeit, in der viele Menschen im Lande, so auch die Stralsunder Pfarrei ums Überleben kämpften, war die ärgste Not bald überwunden. Endlich wurden Kirchensteuern beschlossen und auch das Pfarrgehalt ging regelmäßig ein. Dieses diente in der ersten Zeit überwiegend zur Begleichung der Kirchenausgaben. Oft war die Kasse allerdings zahlungsunfähig. Dass der Pfarrer von seinem Gehalt die Pfarrei mitfinanzieren und der Kaplan im letzten Inflationsjahr ohne Abgabe von Verpflegungskosten beköstigt werden konnte, verdanken beide der Haushälterin, einer ehemaligen Lehrerin, die mit ihrer Pension die Kosten des Haushalts übernommen hatte.
Als Pfarrer Radek nach Stralsund kam, gehörten zur Pfarrei mehrere Tochtergemeinden ohne eigene Gotteshäuser. Wieder einmal musste Geld herangeschafft werden. Bettelbriefe nach Schlesien und ins übrige Deutschland machten es schließlich möglich, dass im Laufe seiner Amtszeit selbstständige Seelsorgstellen in Richtenberg, Damgarten, Zingst und Barth entstanden. Auch das Waisenhaus, das sich in einem kläglichen Zustand befand, konnte in den Jahren 1925/26 erweitert und umgebaut werden.
Man hat ihn oft abfällig einen politisierenden Pfarrer genannt, und manches Gemeindemitglied hätte lieber gesehen, wenn er sich auf die Gemeindearbeit beschränkt hätte. Er wollte immer nur ein ganzer Priester sein, den aber das Geschehen außerhalb der Kirchenmauern nicht gleichgültig ließ. Er wollte Verantwortung tragen gegenüber der Kirche und der ganzen Gesellschaft. Seine Ansicht, dass Kirche und Gesellschaft zusammengehören und dass die staatsbürgerliche Verantwortung nicht vor dem Kirchenportal endet, vertrat er sein ganzes Leben.
In Gedenken an Frau Felicitas Knoppke; verstorben 2024
überarbeitet von Roland Steinfurth
Korrektur Wolfgang Vogt
Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund


Kommentare